Projekt Bauernkrieg 1525/1526 in Salzburg
Am 8. November 2025 wurde die Gastspielausstellung des Salzburg Museum „Heroisch und verklärt – Der Bauernkrieg im Spiegel von Kunst und Diktatur“ im Nordoratorium des Salzburger Doms (DomQuartier) feierlich eröffnet. Bis 27. April 2026 bietet die Ausstellung spannende Einblicke in den Ablauf der Ereignisse im Bauernkrieg der Jahre 1524 bis 1526 in Mitteleuropa und in Salzburg sowie in die kunsthistorische Rezeptionsgeschichte des Themas mit Fokus auf seine Instrumentalisierung unter den Diktaturen und faschistischen Regimen des 20. Jahrhunderts.
Im Bild von links nach rechts: Die Ausstellungskurator:innen Dr. Andreas Zechner und Cornelia Mathe, MA (beide Salzburg Museum), Dr. Andrea Stockhammer, Direktorin DomQuartier, Dr. Doris Fuschlberger (Leiterin Landesprojekt Bauernkrieg) und Dr. Martin Hochleitner, Direktor Salzburg Museum. In den folgenden Bildern ist ein kleiner Einblick in die Ausstellung zu sehen.
Ein Blick in die Vergangenheit für die Zukunft
In den Jahren 2025 und 2026 jähren sich die Ereignisse des sogenannten Salzburger Bauernkriegs zum 500. Mal. In dieser Zeit der Umbrüche vom Mittelalter in die Neuzeit brachten aufständische Bauern, Knappen und Bürger das geistliche Fürstentum Salzburg an den Rand des Untergangs. Trotz regionaler Besonderheiten fügen sich die Ereignisse in einen mitteleuropäischen Kontext von Konflikten um Religion, Herrschaft, Gesellschaft und Kultur.
Zeitgemäße Aufarbeitung
Unter der Federführung des Landes Salzburg wird das Thema in Zusammenarbeit mit der Geschichtswissenschaft der Paris Lodron Universität, Archiven, Landes- und Regionalmuseen, Kultur, Volkskultur, Landwirtschaft, Gemeinden, Tourismus, Wirtschaft, Kunstschaffenden und weiteren Beteiligten aufgearbeitet. Ziel ist, die historischen Ereignisse zeitgemäß in den Mittelpunkt zu stellen.
Programme in allen Bezirken und online
- Ringvorlesung Aufstand. Der ‚Bauernkrieg‘ in Salzburg 1525/26
- Publikationen
- Internationale wissenschaftliche Tagung, 11. bis 13. Februar 2026, Universität Salzburg
- Ausstellungen und Veranstaltungen in Landes- und Regionalmuseen
- Online-Führung „Die Salzburger Bauernaufstände. Geschichten und Objekte aus den Salzburger Regionalmuseen“
- künstlerische Produktionen auf Burgen mit Einbeziehung von Gesellschaft, Gemeinden, Jugend und Tourismus
- Wanderausstellung für Schulen, Veranstaltungen etc.
- zeitgenössische Interventionen in Regionalmuseen (Simultan)
- Film und weitere multimediale Angebote
- Vorträge, Seminare und Diskussionsveranstaltungen
- Stadt-Land-Mensch-Dialoge
- Workshops zu persönlichem Konfliktverhalten, Streitkultur und Demokratie heute
Die Initiativen werden mit Blick auf die regionale Verteilung im gesamten Land Salzburg überregional und im digitalen Raum koordiniert. Die Planungen nehmen Bezug auf die historischen Ereignisse.
Sonderausstellungen und Veranstaltungen in Museen, Burgen, Schulen, Gemeinden und der Universität
Im Bauernkrieg der Jahre 1524 bis 1526 erhob sich die Bevölkerung in weiten Teilen Mitteleuropas gegen die Obrigkeit – so auch in Salzburg. 2025 jähren sich die Ereignisse in Salzburg zum 500. Mal. Das Salzburg Museum widmet sich zu diesem Anlass im Rahmen einer Gastspiel-Ausstellung im Nordoratorium des Doms der Rezeption von Bauernrevolten in der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts. Im Fokus steht die Frage, wie die historischen Ereignisse in unterschiedlichen Epochen, Herrschafts- und Gesellschaftsformen interpretiert und für politische Zwecke instrumentalisiert wurden.
„Knappen, Gold und Widerstand – Aufstand am Silberpfennig“
17. Mai bis 31. Oktober 2026
Im Montanmuseum Altböckstein wird zur Rolle der Bergknappen in den Bauernkriegen exakt 500 Jahre danach eine neue Sonderausstellung geboten. Die Ausstellung zeigt die sozialen Strukturen und Abhängigkeiten, die im Bergbau im Gasteinertal eine Rolle spielten, auf. Originalobjekte, historische Dokumente sowie multimediale Vermittlungsstationen machen den gesellschaftlichen Umbruch greifbar und nachvollziehbar. Eine besonders eindrucksvolle Station zeigt eine KI-konfigurierte Darstellung des Aufstands auf der Erzwies, die in aktuelle Fotografien des historischen Ortes eingebettet ist.
„Bergmann, Bischof, Kaiser“
bis 31. Oktober 2026
Originale Objekte aus der Zeit um 1525 machen die Hintergründe der Aufstände durch die Bauern und Knappen des Erzstiftes Salzburg und der gefürsteten Grafschaft Tirol sichtbar. Stille Zeugen wie die Hl. Katharina aus dem geplünderten Kloster Neustift, das berühmte Portrait des Salzburger Erzbischofes Matthäus Kardinal Lang von Wellenburg oder die Armbrust von Kaiser Maximilian I. zeigen den Prunk, erzählen aber gleichzeitig von den Sorgen und Nöten der damaligen Zeit.
Bauernkriege – Alles eine Frage der Religion?
8. Mai bis 31. Oktober 2026
Die Ausstellung setzt sich mit der Rolle der Reformationsbewegung im Kontext des Bauernkrieges auseinander. Bischof Berthold Pürstinger von Chiemsee versuchte als einflussreiche Persönlichkeit dieser Zeit zwischen den Aufständischen und dem Schwäbischen Bund zu vermitteln und verstarb 1543 in Saalfelden. Man kann mit einem Avatar in der Person von Berthold Pürstinger ins interaktive Gespräch treten. Weiters wurde in Zusammenarbeit mit zwei Schulklassen ein Raum mit ihren Fragen und Lösungen zum Thema Religion und ihrem Lebensumfeld sowie den Bezügen zur Zeit der Bauernkriege entwickelt und gestaltet.
Sturm und Vergeltung!
21. Mai bis 31. Oktober 2026
Die Ausstellung beleuchtet nicht nur die örtliche Ereignisgeschichte, sondern wirft einen Blick auf die am Konflikt beteiligten Akteure und die langfristigen Konsequenzen für die ansässige Bevölkerung. Die Ereignisse von 1525/1526 werden nicht aus der Sicht einer kämpferischen Auseinandersetzung betrachtet, sondern als tiefgreifender sozialer und wirtschaftlicher Umbruch an der Schwelle zur Neuzeit. Die Ausstellung in der Machlhütte macht die Ängste, Hoffnungen und die harte Realität der Menschen in den Dörfern dieser Zeit greifbar. Man kann sich mit einer „digitalen Zeitzeugin“ als KI-generierter Avatarin unterhalten.
Heldengeschichte(n) – Heldentheater!
13. Mai bis 31. Oktober 2026
Wer als Held oder Heldin gilt, hängt von Epoche und Kultur ab, aber auch davon wen man fragt. Ausgehend von der Darstellung, Beschreibung und Inszenierung der Bauernkriegshelden wird thematisiert, wie sich deren Rezeption im historischen Kontext verändert hat, wie sie instrumentalisiert oder wieder vergessen wurden. Wichtig ist aber auch die Auseinandersetzung mit den Helden und Heldinnen der Gegenwart. Die Ausstellung hinterfragt das Thema „Heroisierung“ in Vergangenheit und Gegenwart und regt zur Reflexion an. Man kann sich mit einem Zeller Nachtwächter, einem „digitalen Zeitzeugen“ als KI-generiertem Avatar, unterhalten.
„Er welle uns ganntz verprennen.“ Der Bauernkrieg 1525 und 1526 im Lungau zwischen Gehorsam und Aufruhr
27. Juni bis 31. Oktober 2026
Die Ausstellung setzt das Thema in den Kontext der Wirtschaftskrisen der Neuzeit und zeigt neben dem ereignisgeschichtlichen Ablauf, welche Bevölkerungsgruppen im Lungau beteiligt waren. Weiters beschäftigt man sich mit der regionalen Rezeptionsgeschichte und zieht das Thema in die Gegenwart mit der Frage, wogegen die Bauern heute im Lungau protestieren.
Programmpunkte
- Dienstag, 10. März 2026, 20 Uhr
„Er welle uns ganntz verprennen.“ Der Bauernkrieg 1525 und 1526 im Lungau und im oberen Murtal, Vortrag von Dr. Klaus Heitzmann (Kandolf-Saal, St.-Leonhards-Gasse 10, neben Einfahrt Tiefgarage) - Donnerstag, 9. April 2026, 19 Uhr
„Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand“, Kino enterm Tauern mit Einleitung von Dr. Klaus Heitzmann in Kooperation mit dem Lions Club Lungau und der Lungauer Kulturvereinigung (Kuenburgsaal im Schloss Kuenburg) - Dienstag, 14. April 2026, 19.30 Uhr
„Geheimnisse der Pfarrkirche St. Jakob. Ein Bauwerk spiegelt seine Geschichte wider“. Vortrag und Kirchenführung von Dr. Klaus Heitzmann in der Pfarrkirche (in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk) - Samstag, 27. Juni 2026, 14 Uhr
Eröffnung der Sonderausstellung „Er welle uns ganntz verprennen. Der Bauernkrieg 1525 und 1526 im Lungau“ (Kuenburgsaal im Schloss Kuenburg und Lungauer Heimatmuseum Tamsweg)
Aufgrund der Restaurierungsmaßnahmen ist das Lungauer Heimatmuseum Tamsweg bis 27. Juni 2026 nicht zugänglich.
Vom Bauernaufstand zum selbständigen Bauernstand
17. Mai 2026 bis April 2027
1526 belagerten aufständische Bauern Radstadt. Anfänglich kam es zu beachtlichen Erfolgen, jedoch endete der Versuch der Befreiung im Desaster und im Radstädter Blutgericht. Noch heute zeugen drei Türme an den Ecken der alten Stadtmauern von den Zwangsmaßnahmen, die den Bauern nach der Niederschlagung auferlegt wurden. Die Ausstellung beschäftigt sich neben der Ereignisgeschichte im Ennspongau aber auch mit der Rolle des Buchdrucks im Rahmen des Aufstandsgeschehens im Vergleich zur heutigen Medienentwicklung und soll einen Bogen von der damaligen zur heutigen Landwirtschaft spannen.
Gemeinsam mit dem Referat Kunst, Kultur und Kulturbetriebe des Landes Salzburg unter dem Titel „SIMULTAN“ eine Förderung für künstlerische Projekte ausgeschrieben. Die künstlerischen Interventionen sollen sich inhaltlich mit dem Thema auseinandersetzen. Die vier von einer Jury ausgewählten Arbeiten werden ab Mai 2026 in Regionalmuseen gezeigt.
Gebhard Sengmüller (Schloss Ritzen)
In seiner Installation „Bauernkriegsmaschine“ zeigt Sengmüller die Abhängigkeit kriegerischer Ereignisse von der Informationstechnologie. Dazu gehören beispielsweise eine Trommelkette, die Botschaften über weite Strecken überträgt, ein einfaches Vervielfältigungsgerät für Flugblätter, oder ein mobiles optisches Beobachtungsgerät zur Überwachung von Truppenbewegungen. Das Publikum kann die Geräte selbst ausprobieren: trommeln, drucken, beobachten.
- Eröffnung am Freitag, 8. Mai 2026, 19 Uhr
- Einführende Worte: Katja Mittendorfer-Oppolzer, Kuratorin am Salzburg Museum
Johanna Binder (Lungauer Landschaftsmuseum Mauterndorf)
Krumme Dinger. Konflikte und Widerstand in bäuerlichen Gemeinschaften bestehen bis heute. Im Mittelpunkt der Ausstellung mit großflächigen Zeichnungen und Bildern stehen Auseinandersetzungen, die durch Plantagenwirtschaft entstehen – eine Wirtschaftsform, die oft koloniale Strukturen fortführt und weltweit Landraub, Menschenrechtsverletzungen und Gewalt verursacht. Sie untersucht, mit welchen politischen, wirtschaftlichen und klimatischen Veränderungen diese Konflikte zusammenhängen.
- Eröffnung am Samstag, 2. Mai 2026, 14 Uhr
- Einführende Worte: Karolina Radenkovic, Leiterin der Fünfzigzwanzig, Salzburg
Barbara Holub (Vogtturm)
Die Künstlerin lud zu einer kollektiven Flaggengestaltung ein. Fahnen dienten in den Aufständen der Orientierung und Zugehörigkeit. Demokratie und die damit einhergehenden Rechte sind bei uns so selbstverständlich, das ist aber nicht überall so. Vielfach werden demokratische Bestrebungen wie bei den Bauernkriegen blutig unterdrückt. Bei der Gestaltung setzte man sich mit demokratischen Freiheiten und sozialer Gerechtigkeit auseinander. Zur Eröffnung wird die gemeinsam erstellte Flagge in einer Prozession zum Vogtturm getragen und an seiner Fassade gehisst.
- Prozession und Eröffnung am Sonntag, 17. Mai 2025, 15 Uhr
- Einführende Worte: Tina Teufel, Kuratorin am Museum der Moderne Salzburg
Sonja Böhm (Kapuzinerturm Radstadt)
Die Bäuerin. Wer waren sie, die Bäuerinnen der Frühen Neuzeit, Ehefrauen der aufständischen Bauern und Witwen, über die wir in den Quellen so wenig erfahren? Sonja Böhm versucht in ihrer Installation, den Bäuerinnen der Frühen Neuzeit über die Leerstellen hinweg eine Stimme und ein Gesicht zu verleihen. Sie möchte an die vergessenen Heldinnen der Revolution erinnern, an die Frauen, die sich ohne Männer um Hof, Feld und Kinder gekümmert haben, die als Aufrührerinnen, Botinnen und Versorgerinnen ihren wesentlichen Beitrag zu den Aufständen geleistet haben.
- Eröffnung am Freitag, 24. April 2026, 19 Uhr
- Einführende Worte: Christina Penetsdorfer, Kuratorin
Historisch betrachtet
Am 24. Mai 1525 versammelten sich Gasteiner und Rauriser Bergleute am Silberpfennig. Unter ihrer Führung machten sich Aufständische auf den Weg nach Salzburg. Es wurden Burgen wie Hohenwerfen und Golling sowie die Stadt Hallein besetzt. Auch in der Stadt Salzburg rumorte es. Den ankommenden Aufständischen wurden am 6. Juni die Stadttore geöffnet. Fürsterzbischof Matthäus Lang von Wellenburg saß auf der Festung Hohensalzburg fest, wo er fast drei Monate lang belagert wurde. Am 16. August 1525 rückten die Truppen des Schwäbischen Bundes zur Unterstützung des Fürsterzbischofs nach Salzburg vor. Ende August 1525 erfolgte ein Waffenstillstand. Auf Landtagen im Herbst und Winter wurde über die Beschwerden der Bevölkerung verhandelt. Der zweite Aufstand 1526 begann in Saalfelden und weitete sich auf den ganzen Pinzgau und den Pongau aus. Die Aufständischen scheiterten, das sogenannte Radstädter Blutgericht am 11. Juli 1526 steht für das Ende der zweiten Aufstandswelle. Die autoritäre Kontrolle gegen politischen Widerstand wurde verschärft. Harte gegenreformatorische Politik trieb in den folgenden Jahrhunderten mehr als 20.000 Menschen aus dem Land.
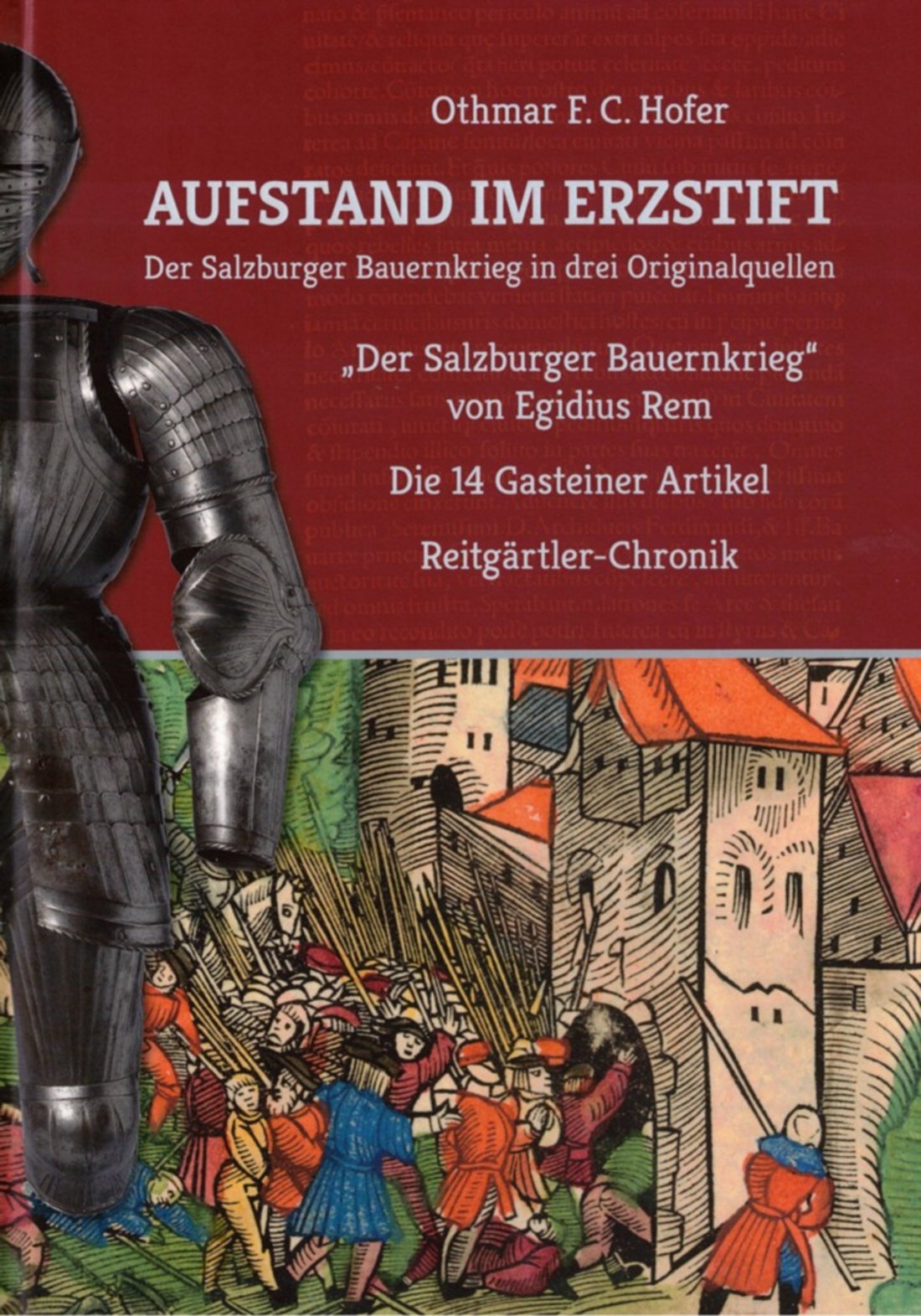
Publikationen
- Aufstand im Erzstift. Der Salzburger Bauernkrieg in drei Originalquellen. Der Salzburger Bauernkrieg von Egidius Rem; Die 14 Gasteiner Artikel; Reitgärtler-Chronik. Hg: Hans Mayer, LILIOM 2025, ISBN 978-3-96606-047-9. 28 Euro. 99 Seiten.
- Rezensionsessay von Martin Knoll über die Bauernkriegsmonografien






