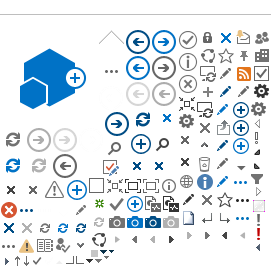Egal ob als Sprengbeauftragter wie Andreas Kendlbacher, der Autofahrer vor Lawinen schützt, oder wie Luftgüte-Experte Martin Loibichler, der unsere saubere Luft überwacht, oder Statistiker Stefan Senn, der vor allem während der Pandemie mit der Aufbereitung der wichtigsten Kennziffern für Ordnung im Daten-Chaos gesorgt hat – ihre Zuverlässigkeit im alltäglichen Job ist es, die das Leben in Salzburg sicherer macht.
Lufteinfänger mit hohem Qualitätsanspruch
Martin Loibichler weiß genau, wo die Luft in Salzburg am saubersten ist. Der Messtechniker leitet seit 2020, unterstützt von zwei Mitarbeitern, das Luftgütemessnetz des Landes mit 13 fixen Standorten und drei mobilen Einheiten. Gemessen werden klassische Schadstoffe wie Ozon, Kohlenmonoxid und Stickstoffdioxid, die für Menschen mit Atembeschwerden bedeutend sind, aber auch von Großbetrieben ausgestoßenes Schwefeldioxid sowie Feinstaub und Ultrafeinstaub, die in Salzburg bis auf Nanopartikelgröße genau nachgewiesen werden können.
Meteorologie zur Berechnung
Genauso wichtig sind Meteorologiedaten wie Luftdruck, Temperatur und Wind, um Herkunft und Ausbreitung der Stoffe genau berechnen und vorhersagen zu können. „Die Geräte sind hochsensibel und werden laufend gewartet, damit die Messwerte europaweit vergleichbar sind“, erklärt Loibichler.
Ordnung im Daten-Chaos
Stefan Senn arbeitet seit zwei Jahren bei der Landesstatistik. Sein Start war geprägt von der Pandemie. Statistische Erhebungen waren gefragt wie nie zuvor. Seine Aufgabe ist primär die Datenaufarbeitung. „Ich bekomme sie in unterschiedlichen Formen. Ich bündle und verknüpfe sie, damit eine Aussage getroffen werden kann. Es ist sehr zeitintensiv und benötigt viel Knowhow, bis eine Grafik entsteht“, sagt Senn, der anfügt: „Wichtig ist das gegenseitige Verständnis für die Tätigkeit von anderen Kolleginnen und Kollegen. Beispielsweise können wir nur mit Zahlen arbeiten, die wir nachvollziehen und verstehen. Deshalb ist die Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit allen Abteilungen im Land zentral.“
Dinge zählen und Muster erkennen
Auf den ersten Blick ist es etwas seltsam: ein gelernter Bioinformatiker als Datenanalyst. „Aber die Väter der modernen Statistik waren großteils Genetiker. Man zählt Dinge und schaut, ob es Zufall ist oder ein Muster. Und genau so funktioniert auch die Erstellung von statistischen Analysen. Wir versuchen allfällige Muster zu erkennen“, erklärt Senn.
Bei einer Sprengung muss alles passen. Entscheidend ist da auch die akribische Vorbereitung.
Andreas Kendlbacher, Sprengstoffexperte
Der Sprengbeauftragte
Drei Sprengbeauftragte arbeiten im Landesdienst, alle in der Straßenmeisterei Bruck an der Großglocknerstraße. Andreas Kendlbacher ist einer davon. Sein Einsatzgebiet liegt in 1.700 bis 1.800 Metern Seehöhe hoch über dem Saalachtal zwischen Weißbach und Saalfelden, am Eingang zum Glemmtal sowie oberhalb der Rauriser Landesstraße.
Hochexplosives auf den Bergen
Gesprengt werden Gefahrenstellen, bei denen sich Lawinen oberhalb von wichtigen Verkehrsrouten aufbauen können. Oben am Berg stehen sechs Meter hohe, mit Solarstrom versorgte Türme mit jeweils zwölf Sprengladungen. Gezündet wird über eine Internetverbindung. „Ich bin nicht im Gelände, sondern am Computer in der Tunnelwarte in Bruck, wo ich sonst auch arbeite“, erklärt Kendlbacher. Und weiter: „Im Tal hält ein Kollege Funkkontakt und sperrt die Straße.“
Sicherheit geht vor
„Vor der Sprengung arbeiten wir eine Liste ab, wer verständigt werden muss: Gemeinde, Grundbesitzer, Polizei. Sie stellen sicher, dass niemand mehr im Gefahrenbereich ist“, verweist Kendlbacher auf die Informationskette. Vor der Zündung gibt es eine Viertelstunde Sicherheitspuffer. Direkt am Sprengturm ertönt ein lautes Warnsignal, falls sich Tourengeher in der Nähe befinden. Es dauert dann rund fünf Minuten, bis die Ladung „scharf“ ist. Die Straße im Tal wird kurz gesperrt. „Mein Kollege meldet mir per Funk, ob es geknallt hat. Dann warten wir noch 15 Minuten ab, ob etwas nachkommt“, erzählt er aus der Praxis. REP_220518_50 (grs/mel)