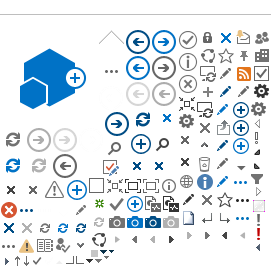Die Anfänge des Domkapitels sind bis heute nicht restlos geklärt. Nachdem Bischof Vigil am 24. September 774 den Dom geweiht hatte, gab es vielleicht schon ein Priesterkollegium am Dom, das im 10. Jahrhundert formell sicher schon bestanden hat. Erzbischof Konrad I schrieb dem bereits existierenden Domkapitel die Regel des heiligen Augustinus vor. Er setze die Anzahl der Domherren auf 24 fest und verpflichtete sie zu einem gemeinsamen Leben in Arbeit und Gebet. 1514 wurde dieses Chorherrenstift in ein weltpriesterliches Kollegium umgewandelt. Ab der frühen Neuzeit wurden daher in der Kapitelgasse und im Kaiviertel prächtige Domherrenhäuser errichtet. Bis Ende 1806 bestand dieses Domkapitel in seinen alten Satzungen.
Einflussreiche Machtposition
Die Salzburger Domherren hatten im Erzstift sowie in der Erzdiözese eine zentrale Machtposition. Sie waren quasi das weltliche und geistliche Gegengewicht zum Erzbischof und einer der wichtigsten Grundbesitzer mit vielen Ländereien. Seit dem Hochmittelalter hatten sie auch die Aufgabe den Erzbischof zu wählen. Nur Adelige aus dem eigenen Umkreis kamen zum Zuge, Außenstehende hatten kaum eine Chance.
Im Einsatz für Dom und Kirche
Seit zwölf Jahren ist Roland Peter Kerschbaum Mitglied des Domkapitels. Der Pfarrer von Salzburg-Aigen sowie Elsbethen und Diözesankonservator der Erzdiözese kennt die Arbeit im Priesterkollegium aus erster Hand. Im Gespräch mit dem Landes-Medienzentrum (LMZ) informiert der Geistliche über seine Arbeit im Domkapitel.
LMZ: Herr Kerschbaum, wie wurden Sie als Mitglied des Domkapitels ausgewählt?
Kerschbaum: 2011 wurde ich Diözesankonservator und bin seither mit dem Bauamt der Erzdiözese für die rund 900 Gebäude in Salzburg und Tirol zuständig. Diese wichtige verantwortungsvollle Aufgabe in der Kirche war wohl der Grund, warum ich 2013 ins Domkapitel berufen wurde.
LMZ: Wie hat sich die Zusammensetzung des Domkapitels in den vergangenen Jahren geändert?
Kerschbaum: Bis vor knapp 30 Jahren war das Domkapitel ident mit dem Konsistorium, dem obersten Beratungsgremium des Erzbischofes, wo alle zentralen Behördenleiter der Erzdiözese vertreten sind. Etwa Bildung, Finanzen, Personal oder auch Seelsorge. Da aber immer mehr Laien diese Ämter leiten veränderte sich die Zusammensetzung. Grundsätzlich ist der Erzbischof frei in seiner Entscheidung, welchen Geistlichen er in das Domkapitel beruft. Aber wir Domkapitel-Mitglieder machen einen Vorschlag, an den sich der Erzbischof in der Regel hält.
LMZ: Wie können sich Außenstehende die Arbeit der Mitglieder des Domkapitels vorstellen? Treffen sie sich regelmäßig oder wenn die Wahl eines neuen Erzbischofes ansteht?
Kerschbaum: Das Domkapitel an sich tagt regulär vier Mal im Jahr. Unsere wesentliche Aufgabe ist die Verwaltung des Domes, seiner Liegenschaften sowie die Domliturgie und die Pflege der Gemeinschaft in Gebet und gutem Miteinander. Auch für die Dommusik und das Dommuseum sind wir im Bereich der Domkustodie zuständig. Bei Salzburgs größter Kirche müssen wir viele Interessen unter einen Hut bringen. Der Dom ist Pfarr- und Bischofskirche und wird vom Kapitel verwaltet. Hier gibt es viele Partner mit denen wir gut zusammenarbeiten und Synergien nutzen. Und ganz wichtig: Als Domkapitel sind wir eine geistliche Gebetsgemeinschaft, wo wir uns gegenseitig unterstützen.
LMZ: Welche Bedeutung hat das Domkapitel bei der Wahl des Erzbischofes?
Kerschbaum: Die Mitglieder des Domkapitels entscheiden heute aus einem Dreier-Vorschlag aus Rom, wer Erzbischof in Salzburg wird. Bis 1933/34 – dem Inkrafttreten des Konkordates zwischen dem Heiligen Stuhl und Österreich – verfügte das Domkapitel über ein freies Wahlrecht, weshalb die meisten Erzbischöfe dem Domkapitel entstammten. Das änderte sich danach, da das Domkapitel nun aus dem Dreier-Vorschlag einen Bewerber auswählen muss. Beispielsweise waren Franz Lackner, Alois Kothgasser oder Georg Eder nicht Mitglieder des Domkapitels bevor sie die Nachfolge Ruperts antraten. REP_250113_91 (msc/mel)